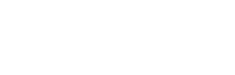Zu diesem Heft:
Arbeit ist ein Thema, das zwar aktuell, keineswegs aber neu ist. Bloßes Nichtstun, so die leidige Erfahrung dessen, der über keinerlei ökonomische oder sonstige materielle Ressourcen verfügt, ist weder der gesellschaftlichen, noch - dies schon gar nicht - der individuellen Reproduktion dienlich; die unmittelbare Anknüpfung an die Lebenswelt jener Vögel, die zwar nicht säen, aber dennoch ernten, ist leider nicht die Regel. Zudem müssen sich auch jene, die ernten, ohne gesät zu haben, fragen lassen, wer für die einstige Aussaat Sorge getragen hat. Die Auseinandersetzung mit dem Problem der Arbeit ist das möglicherweise zukunftsträchtigste Thema, das die Linke im weitesten Sinne seit jeher beschäftigt. Nicht nur Marx hatte sich dem Kampf gegen die Arbeit verschrieben und von einer Gesellschaft geträumt, in der Müßiggang zu den Grundrechten eines jeden einzelnen gehören würde. „Die ‘Arbeit’,so hatte er bereits im Jahre 1845 erkannt, „ist ihrem Wesen nach die unfreie, unmenschliche, ungesellschaftliche, vom Privateigentum bedingte und das Privateigentum schaffende Tätigkeit. Die Aufhebung des Privateigentums wird also erst zu einer Wirklichkeit, wenn sie als Aufhebung der ‘Arbeit’ gefaßt wird.“ Diese Erkenntnis hat jedoch weder in der sozialdemokratischen noch in der parteikommunistischen Arbeiterbewegung irgendwelche Früchte getragen; statt dessen hat sich die traditionelle Arbeiterbewegung schon frühzeitig in den produktivistischen Mythen der bürgerlichen Fortschrittsideologie verfangen. Die Kritik der bzw. der Kampf gegen die Arbeit sowie das „Recht auf Faulheit“ wurden in die Marginalität abgedrängt, ehe sie vom technologischen Fortschritt, der im Zuge der aktuell „Globalisierung“ genannten Internationalisierung des Kapitals zunehmend potentielle Arbeitskraft als überflüssiges Menschenmaterial aus seiner Verwertungsmaschinerie entläßt, wieder auf die Tagesordnung gesetzt wurden. Die Rekonstruktion der verwehten Spuren einer arbeits- und verwertungskritischen Theorie und Praxis wird von daher sicherlich zu den sowohl wichtigsten als auch interessantesten Aufgaben einer dem technologischen Fanatismus gegenüber skeptischen Linken gehören. Mit seinem Beitrag über Franz Jungs ganz wesentlich durch seine Erfahrungen in und mit den revolutionären Ereignissen der Jahre nach 1918 angeregten Überlegungen zu einer individuelles Lebensglück verheißenden Arbeit liefert Walter Fähnders einen Beitrag zur Rekonstruktion eben jener antiproduktivistischen Tradition, die es zu wieder zu entdecken gilt. Jung hat die Arbeitsproblematik im Spannungsfeld zwischen Einzelnem und Gemeinschaft angesiedelt; er rekurriert dabei u.a. auf frühsozialistische Ansätze einer positiven Bestimmung von Arbeit im Sinne einer in die Gemeinschaft eingebundenen, gleichwohl aber individuellen Glücksverheißung. Insofern Jungs Ansatz weder ökonomisch noch historisch, sondern, unter dem Einfluß von Otto Gross, ganz wesentlich psychologisch bestimmt ist, bewegt er sich einerseits zwar noch in den Grenzen einer protestantisch fundierten Arbeitsethik, überschreitet diese aber gleichwohl, indem er bürgerliche Individualität in einer wohl mehr ersehnten als real erlebten Gemeinschaft aufhebt.
Franz Jung hat sich in späteren Jahren, durchaus auch in Fortsetzung des nicht nur für sein gesamtes Werk, sondern auch sein eigenes Leben bestimmenden Themas der Spannung zwischen Einzelnem und Gemeinschaft, mit Außenseitern und ketzerischen Bewegungen auseinandergesetzt. Zu diesem Werkkomplex gehört auch die von Walter Fähnders und Andreas Hansen kommentierte, bisher ungedruckte Fassung eines Essays, das von der Wiederkehr eines ermordet geglaubten Schulmeisters im von religiösen Auseinandersetzungen geprägten England des 17. Jahrhunderts berichtet. Die auf den ersten Blick eher unscheinbare Geschichte dient Jung zu eher kursorischen als explizit ausgearbeiteten Überlegungen zur Bedeutung des Einzelnen auf dem Hintergrund einer über ihn hinwegrollenden und ihn geradezu vernichtenden Geschichte. Verschwinden und Wiederkehr waren für Jung zu der Zeit, als er den Text schrieb - im Jahre 1960 - längst zu wichtigen Themen geworden, nicht zuletzt auf dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrungen in der kommunistischen Bewegung der verflossenen Jahrzehnte; „der Kommunismus“, so heißt es am Ende des Textes, „wird an dem Lachen der Hingerichteten ersticken“. Jung selbst wird sich zu dieser Zeit zu den vom stalinistischen Kommunismus zumindest symbolisch Hingerichteten gezählt haben; seine damalige Beschäftigung mit Häretikern und Ketzern wird er als seinen Beitrag zu diesem Lachen verstanden haben.
Ob und inwieweit die KPD in den zwanziger und dreißiger Jahren eine als Partei organisierte Sekte gewesen ist, sei einmal dahingestellt; daß sie in politischer Hinsicht allzuoft reichlich sektiererische Positionen vertreten hat, ist allerdings unbestritten. Wie dies allerdings seinerzeit vornehmlich von den einfachen Mitgliedern empfunden wurde, dürfte schwerlich, allenfalls noch in Ansätzen zu ermitteln sein, da entsprechende Zeugnisse weitgehend fehlen. Ulrich Eumann unternimmt in seinem Beitrag auf der Basis von rund hundert ausgewerteten Autobiographien ehemaliger KPD-Mitglieder den Versuch, jenseits von traditioneller Organisations- und Ideengeschichte den Parteialltag der eher gewöhnlichen Parteimitglieder zu beleuchten. Dabei stehen zum einen kognitive Aspekte des Parteialltags wie Leseverhalten oder Schulungen, zum anderen eher praktische Aspekte wie Beitritt, Mitgliedsbeiträge, Versammlungen, politische Alltagsarbeit oder Gewerkschafts- und Betriebspolitik im Zentrum seines Interesses. Es versteht sich von selbst, daß die Erkenntnisse zum Parteialltag auf der Basis der herangezogenen Quellen notwendigerweise beschränkt sind, nichtsdestotrotz erhellen sie mosaikartig die Vielfalt der durchaus nicht einheitlichen Interessen, Mentalitäten und Zielvorstellungen der in der KPD zusammenkommenden und aufeinandertreffenden Personen.
Am Ende des 20. Jahrhunderts können Parteikommunisten, insbesondere jene, die, von bürgerlichen Intellektuellen theoretisch geadelt, ihre aus dem Denken des bürgerlichen Idealismus gespeisten geschichtsphilosophischen Fiktionen mit durchweg terroristischen Mitteln Realität haben werden lassen, für sich in Anspruch nehmen, eine grundlegend emanzipatorische Idee für unabsehbare Zeit diskreditiert zu haben. Im Gegensatz zu parteikommunistischen Organisationen, die dem Modell bürgerlicher Politik verhaftet blieben, haben syndikalistische Organisationen immer auf die autonome Selbstorganisationen und Selbstverwaltung der Arbeiter abgezielt. Insofern sie sich auf das Spiel bürgerlich politischer Repräsentation nicht eingelassen haben, sind ihre Organisationen allerdings immer auch der Gefahr erlegen, zeitlich und räumlich begrenzt zu agieren; das Konzept eines auf direkten Aktionen basierenden gesellschaftlich umfassenden Generalstreiks mit dem Ziel einer allgemeinen Selbstverwaltung jedenfalls hat sich nicht durchsetzen können. Die Zersplitterung der syndikalistischen Bewegungen, deren Hochzeit in den Jahrzehnten zwischen 1890 und 1930 anzusiedeln ist, hat ganz beiläufig auch dazu geführt, daß ihre Erforschung noch zahlreiche Lücken aufzuweisen hat. Hartmut Rübner beschäftigt sich in seinem Beitrag mit syndikalistischen Organisationsversuchen im Schiffahrtsbereich, insbesondere in den Jahren nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Deutlich wird dabei, daß die jeweiligen betrieblichen Strukturen, die spezifischen Arbeitsverhältnisse, die Einbindung der Seeleute in ihre vergleichsweise abgeschotteten Milieus und die damit zusammenhängenden Mentalitäten eine wichtige Rolle bei Konflikten und im Organisationsverhalten spielten. Ausgangspunkte syndikalistischer Organisationsversuche, die gerade im Schiffahrtsbereich internationale Dimensionen erlangten, waren betriebliche Auseinandersetzungen, die mit den Mitteln der direkten Aktion ausgetragen wurden. Erfolge und Scheitern syndikalistischer Gruppierungen im Milieu der Seeleute waren verknüpft mit konjunkturellen Entwicklungen, mit Rationalisierungsprozessen und der damit einhergehenden Auflösung von tradierten Sozialmilieus sowie der schließlichen Einbindung des maritimen Arbeitsmarktes in ein konfliktdämpfendes Tarifrecht.
Syndikalistische Bewegungen und Gruppierungen fanden sich nicht nur in den damals bereits fortgeschrittenen Industriestaaten, sondern gerade auch in Ländern, deren Industrialisierung sich noch im Anfangsstadium befand. In den zehner Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts lassen sich erste syndikalistische Organisationsversuche in Südafrika nachweisen. Wie Lucien van der Walt in seinem Beitrag aufzeigt, war die frühe weiße südafrikanische Arbeiterbewegung von rassistischen Vorurteilen gegenüber Schwarzafrikanern bestimmt. Es waren Syndikalisten, die den Rassismus auch der weißen Arbeiter im Kontext der sozialen Auseinandersetzungen thematisierten und mit den „Industrial Workers of Africa“ den ersten Versuch einer Organisierung schwarz-afrikanischer Arbeiter unternahmen. Paul Henderson gibt in seinem Beitrag einen Überblick über den Einfluß anarchistischer und syndikalistischer Ideen und Organisationen in den Ländern Südamerikas. Die Kapitalisierung der südamerikanischen Wirtschaft und die daraus resultierenden sozialen Probleme, die mit der politischen Entrechtung großer Bevölkerungsteile einhergingen, führten in den Anfangsjahren des zwanzigsten Jahrhunderts zu einer zunehmenden Radikalisierung der südamerikanischen Arbeiterschaft, die in vielfach gewalttätigen Streiks und Auseinandersetzungen ihren Ausdruck fand. In den zwanziger Jahren wurden syndikalistische Organisationen zum einen Opfer staatlicher Repression, zum anderen gewannen zunehmend parteikommunistische und sozialistische Organisationen an Einfluß.
Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre, als sich zum einen die Kommunistische Partei Italiens im System eingerichtet und etabliert hatte, zum anderen aber die Klassenauseinandersetzungen, vorangetrieben im wesentlichen von aus Süditalien in die großen Fabriken des Nordens ausgewanderten Massenarbeitern, sich verschärften, war es eine Gruppe jüngerer Theoretiker um Raniero Panzieri, damals Mitglied der Sozialistischen Partei Italiens, die, auf der Basis einer erneuten Marx-Lektüre sowie konkreter Arbeiteruntersuchungen in den Fabriken des Nordens, das Konzept einer nicht von der Partei gesteuerten und entsprechend vereinnahmbaren Arbeiterkontrolle erarbeitete. In der von Panzieri zwischen 1961 und 1963 in sechs Heften herausgegebenen Zeitschrift „Quaderni Rossi“ wurden eine ganze Reihe von Beiträgen veröffentlicht, die zu einer nicht nur, aber insbesondere für die italienischen Diskussionen und Auseinandersetzungen der späten sechziger und siebziger Jahre wichtigen Neuinterpretation des Marxismus in dem Sinne beitrugen, daß die Arbeiterklasse als das eigentliche Subjekt nicht nur im revolutionär-transzendierenden Sinne, sondern des kapitalistischen Produktionsprozesses überhaupt, als wichtigste und entscheidende Produktivkraft also, wiederentdeckt wurde. Nachdem Panzieri, der theoretische Kopf dieser als „Operaismus“ bekannt gewordenen Neuinterpretation des Marxismus, bereits 1964 gestorben war, entwickelten sich seine damaligen Mitstreiter in verschiedene Richtungen. Während Mario Tronti in die Kommunistische Partei zurückkehrte, erweiterte Toni Negri auf dem Hintergrund der späteren, über die fabrikbezogenen Arbeiterkämpfe hinausreichenden sozialen Auseinandersetzungen den Begriff des Massenarbeiters zum Begriff des gesellschaftlichen Arbeiters und wurde damit zum theoretisch einflußreichen Interpreten der autonomen Bewegungen der siebziger Jahre. 1994, dreißig Jahre nach dem Tod Panzieris, fand in Pisa eine Konferenz statt, deren Organisatoren sich das Ziel gesetzt hatten, wichtige und zentrale Aspekte des Werkes von Panzieri auf dem Hintergrund sowohl der mittlerweile erfolgten kapitalistischen Umstrukturierungen als auch der Erfahrungen, die im Widerstand gegen diese Umstrukturierungen gemacht wurden, neu zu hinterfragen. Die Beiträge von Luciano Della Mea, Maria Turchetto, Fedele Ruggeri, Sergio Garavini und Gianfranco Pala sind allesamt der 1995 in Buchform erschienenen Dokumentation dieses Kongresses entnommen. Es geht in diesen Beiträgen nicht so sehr um eine Interpretation oder Rekonstruktion bestimmter Aspekte des Werkes von Panzieri, sondern vielmehr um den Versuch einer produktiven Aneignung im Hinblick auf die Analyse der Fortschritte und Umbrüche im kapitalistischen Produktionsprozeß der letzten Jahrzehnte. Im Mittelpunkt der Beiträge steht auf unterschiedliche Weise das eigentlich zentrale Anliegen Panzieris, die Kritik des objektivistisch argumentierenden traditionsmarxistischen Produktivismus und die Frage der Wiederaneignung von Subjektivität zwecks Aufhebung des letztlich bürgerlichen Paradigmas technologischen Fortschritts.
Panzieris Überlegungen zur Arbeiterkontrolle sind sicherlich auch von den Ereignissen in Polen und Ungarn im Jahre 1956 inspiriert gewesen. In Frankreich hatte die Gruppe um die Zeitschrift „Socialisme ou Barbarie“ bereits seit Ende der vierziger Jahre im Rückgriff auf rätekommunistische Traditionen in der Arbeiterbewegung dem produktivistischen Marxismus in Gestalt der von Lenins Realpolitik inspirierten und unter Stalin ausgeweiteten terroristischen Bürokratien eine deutliche Absage erteilt. Als die ungarischen Aufständischen im Herbst 1956 das parteikommunistische Terrorregime stürzten und die Frage der Arbeiterselbstverwaltung stellten, war es Claude Lefort, der in einem damals ganz aktuellen Beitrag für die Zeitschrift „Socialisme ou Barbarie“ den Spuren und Artikulationen der ungarischen Arbeiterräte nachspürte. Der ungarische Aufstand wurde unter Einsatz sowjetischer Panzer niedergeschlagen, die Erfahrungen der Arbeiterräte allerdings bleiben exemplarisch für jene Tradition der Arbeiterbewegung, die gegen die von bürgerlichen Intellektuellen vertretene Ansicht, derzufolge eine Partei die Interessen der Arbeiter in den Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft zu vertreten und schließlich diese Institutionen zu erobern und zu besetzen habe, an Konzepten der Selbstorganisation und Selbstverwaltung festhält.
An solche Konzepte knüpfte die Gruppe „Socialisme ou Barbarie“ auch in ihrer eigenen Betriebsarbeit an. Angesichts der bürokratischen Erstarrung und des im System des Realsozialismus sich manifestierenden Scheiterns traditionsmarxistischer Machtstrategien sollten die realen Arbeiter und die von ihnen in der konkreten Arbeitswelt erlebten und ausgetragenen Konflikte wieder ins Blickfeld geraten. Revolutionäre Subjektivität konnte, dies hatte die Theorie und Praxis des sozialdemokratischen und parteikommunistischen Marxismus zur Genüge gezeigt, nicht durch eine Partei substituiert werden. Die kapitalistischen Arbeitsverhältnisse konnten nur vor Ort und nur von denen aufgehoben werden, die sie als Arbeitssubjekte erst konstituierten. Demzufolge ging es dem Ansatz von „Socialisme ou Barbarie“ erst einmal darum, diese Arbeitsverhältnisse vor Ort zu untersuchen und die in ihnen sich artikulierende Subjektivität der Arbeiter zu organisieren. Andrea Gabler skizziert in ihrem Beitrag die entsprechenden Konzepte einer „Arbeitsforschung in revolutionärer Absicht“, stellt die Ergebnisse dieser Untersuchungen vor und rekapituliert schließlich die Schwierigkeiten, die sich bei der Interpretation der vorgelegten Berichte aus der Arbeitswelt gerade auch im Hinblick auf die Verbindung der betrieblichen Kämpfe mit den Auseinandersetzungen in anderen gesellschaftlichen Bereichen ergaben.
Die Gespräche mit zwei ehemaligen Mitgliedern der Gruppe „Socialisme ou Barbarie“, Henri Simon und Daniel Mothé, lassen einige Aspekte der inhaltlichen Arbeit sowie der Konflikte innerhalb der Gruppe noch einmal in subjektiver Sichtweise Revue passieren. Beide sind nicht als klassische Intellektuelle, sondern als Arbeiter Mitglied der Gruppe geworden. Während Mothé bis zur Auflösung im Jahre 1965 Mitglied blieb und sich zunehmend in der tradierten Gewerkschaftsarbeit engagierte, hatte Simon die Gruppe im Rahmen einer ersten größeren Spaltung bereits im Jahre 1958 verlassen, um zukünftig in kleineren rätekommunistisch orientierten Gruppierungen aktiv zu bleiben. Insbesondere das Gespräch mit Simon reicht - entsprechend seinem politischen Engagement - thematisch weit über den engeren Kontext von „Socialisme ou Barbarie“ hinaus und vermittelt ganz beiläufig auch einen ersten Einblick in die Vielfalt der seit Mitte der sechziger Jahre, insbesondere im Kontext des Mai ‘68, entstehenden linksradikalen und linkskommunistischen Gruppierungen.
Der theoretisch führende Kopf der Gruppe „Socialisme ou Barbarie“ war ohne Zweifel Cornelius Castoriadis. Nach seinem Tod im Dezember 1997 ließ Daniel Blanchard, der selbst Mitglied der Gruppe gewesen war, in einer Art Nachruf den theoretischen Lebensweg von Castoriadis noch einmal in aller Kürze Revue passieren. Blanchard betont die Bedeutung, die in Castoriadis’ Konzept der Selbstverwaltung der Subjektivität zukommt, eine Bedeutung, die, so Blanchard, durchaus als Annäherung an libertäre Traditionen verstanden werden kann.
Cornelius Castoriadis selbst hat sich in seinem letzten zu Lebzeiten veröffentlichten Text noch einmal mit den aktuellen Entwicklungen der kapitalistischen Gesellschaften auf der Basis der dem Kapitalismus qua Selbstzuschreibung eigenen „Rationalität“ beschäftigt. Auf dem Hintergrund einer seit mittlerweile rund zwanzig Jahre anhaltenden ideologischen und politischen Regression, die alle Erkenntnisse über die historisch gewachsenen Strukturen des kapitalistischen Systems und der einstmals selbstverständlichen Relativierung oder gar Infragestellung dieser Strukturen souverän mißachtet, hinterfragt Castoriadis einmal mehr unter Hinweis auf die möglichen und absehbaren Konsequenzen die Logik dieses Systems. In dem Maße, in dem die berüchtigte Zweckrationalität des kapitalistischen Systems als nicht mehr hinterfragbare und nicht in Bezug auf andere, vorangehende und mögliche nachfolgende gesellschaftliche Systeme relativierbare, von den Ideologen und Praktikern des Systems instituierte Ideologie oder gar als längst verselbständigter Mythos allgemein anerkannt wird, droht die immanente Logik dieser Zweckrationalität - der als Wohlstand ideologisierte Profit um des Profites willen - alle sozialen, politischen, ökologischen oder auch ökonomischen Bedenken und Grenzen zu überrollen. Das Projekt einer von autonomen Individuen selbst verwalteten Gesellschaft scheint angesichts der zweckrationalen Logik einer sich zunehmend globalisierenden kapitalistischen Ökonomie dem historischen Vergessen anheimgegeben. Allerdings verfällt Castoriadis keinem blinden Ökonomismus; die zukünftigen Entwicklungen hängen letztendlich „von den Reaktionen und Aktionen der Bevölkerungen in den betroffenen Ländern ab“, von deren Willen also, aus eigener Entscheidungskraft und Handlungsfähigkeit eine andere Gesellschaft mit einer anderen „Rationalität“ zu etablieren.
Diese andere „Rationalität“ wird sich sicherlich in einer im eigentlichen Sinne des Wortes radikalen, an die Wurzeln gehenden Weise mit dem insbesondere im calvinistischen Protestantismus im Rahmen der innerweltlichen Askese geradezu heilsgeschichtlich ideologisierten und ontologisierten Konzept der Arbeit auseinandersetzen müssen. Einmal abgesehen davon, daß die Entwicklung der modernen Technologien das tradierte industrielle Verständnis von Arbeit und damit auch die ihm zugrundeliegende ideologische Basis gewissermaßen immanent zunehmend problematischer erscheinen läßt, ist das in offensichtlich herrschaftssichernder Absicht allen diesbezüglich aufbrechenden Widersprüchen zum Trotz weiterhin positiv ideologisierte westliche Konzept von Arbeit überhaupt in Frage zu stellen. Der traditionelle Marxismus hat sich das bürgerlich-positivistische Konzept von Arbeit im eher banalen Sinne einer Sicherung des Lebensunterhalts nicht nur angeeignet, sondern im revolutionsstrategisch begründeten Bezug auf den klassischen Industriearbeiter sogar noch ideologisch zu überhöhen vermocht. Das von Marx’ Schwiegersohn Paul Lafargue zur Diskussion gestellte „Recht auf Faulheit“ konnte in diesem Kontext allenfalls als schwer verdauliche Satire goutiert werden. Von einem garantierten „Recht auf Faulheit“ mag zwar auch heute noch niemand sprechen, die Krise der Arbeit allerdings ist mittlerweile in aller Munde und die Konzepte zur Meisterung dieser Krise, ob apologetisch oder kritisch, sind auch für Eingeweihte kaum noch zu überblicken. Jacques Wajnsztejn thematisiert in seinem Beitrag zum einen einige wesentliche Erscheinungsformen der in den letzten Jahren sich wandelnden Arbeitsorganisation und gibt dabei zum anderen einen verschiedene Debatten aufgreifenden Überblick über die aus der Krise der Arbeit folgenden Konsequenzen für die tradierte Politik von Arbeiterorganisationen sowie den sozialen Zusammenhalt der von der Krise der Arbeit betroffenen Gesellschaften. Angesichts der mit der Krise der Arbeit einhergehenden Zersplitterung der sozialen Interessen und - daraus folgend - der sozialen Auseinandersetzungen ist, so Wajnsztejn, das Feld der Politik neu zu definieren und in Verbindung mit den sozialen Kämpfen neu zu besetzen.
Während zur Sozialgeschichte unterschiedlichster syndikalistischer Bewegungen und Organisationen in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Arbeiten publiziert wurden, sind viele Protagonisten dieser Bewegungen, insbesondere hierzulande, wo die Beschäftigung mit der Geschichte des Anarchismus und Syndikalismus keinen Eingang ins Milieu zünftiger Historiker gefunden hat, längst in Vergessenheit geraten. Christian Cornelissen gehörte in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, nicht zuletzt als Herausgeber des in vier Sprachen erschienenen „Bulletin International du Mouvement Syndicaliste“, zu den bekanntesten Aktivisten und Publizisten der anarchosyndikalistischen Bewegung. Die Beiträge von Homme Wedman und Jeff Stein vermitteln einen ersten Eindruck von den Aktivitäten und insbesondere auch von dem theoretischen Werk Cornelissens. Während sich Wedman im wesentlichen auf eine historiographische Darstellung beschränkt, hinterfragt Stein auch die mögliche Aktualität von Cornelissens Werk, wobei er sich durchaus bewußt ist, daß, da auch umfassende theoretische Entwürfe weitgehend zeitgebunden bleiben, solcherlei auch aus der Rezeption anderer „Klassiker“ zur Genüge bekannten Aktualisierungen immer problematisch sind.
In den Augen von Franz Jung war der schon frühzeitig abtrünnige Freud-Schüler Otto Gross eine Art Vorläufer des zwischenzeitlich fast schon berühmten, mittlerweile aber schon wieder weitgehend vergessenen Wilhelm Reich. Vielleicht ist gerade dies ein Grund, nach mancherlei nicht recht gelungenen, zumindest die Rezeption nicht allzu anregenden Versuchen einer Wiederentdeckung einmal mehr auf Otto Gross aufmerksam zu machen. Der Beitrag von Raimund Dehmlow und Rolf Mader nimmt einen Brief von Guste Ichenhäuser an Felix Noeggerath aus der Zeit der Münchener Räterepublik, in dem die Rede von Otto Gross ist, zum Anlaß, die Einbindungen von Gross in die Münchener Bohème-Szenerie und insbesondere seine Ansichten über den Zusammenhang von psychoanalytischen Ideen und gesellschaftlichen Strukturen, von patriarchalen Denk- und Handlungsstrukturen und individueller Befreiung zu thematisieren.
Nach der Ermordung Erich Mühsams im Konzentrationslager Oranienburg im Juli 1934 war seine Lebensgefährtin Zensl Mühsam über Prag nach Moskau emigriert, wo sie zwei Jahre später im Zuge der sogenannten „Säuberungen“ verhaftet und inhaftiert wurde. Im libertären Milieu Frankreichs kam es daraufhin, unterstützt auch von Victor Serge, der selbst gerade erst im Anschluß an von vielen bekannten französischen Intellektuellen unterstützte Proteste aus sowjetischer Haft entlassen worden war, zu einer Solidaritätskampagne, die dazu führte, daß Zensl Mühsam im Herbst 1937 vorläufig frei kam, ehe sie rund ein Jahr später wieder verhaftet wurde. Der Beitrag von Charles Jacquier skizziert diese Solidaritätskampagne und dokumentiert einen Brief des libertären Pazifisten Jean-Paul Samson an Romain Rolland, in dem er an diesen appelliert, sich für die Freilassung Zensl Mühsams einzusetzen.
Die russische Oktoberrevolution von 1917 gehört unbestritten zu den historisch entscheidenden Ereignissen des zwanzigsten Jahrhunderts; genauso unbestritten dürfte sein, daß ein solches Ereignis ohne die dazugehörige Vorgeschichte, insbesondere auch die ideologische Tradition, aus der die Protagonisten der Oktoberrevolution ihre Legitimation bezogen haben, nicht verstanden werden kann. Um so erstaunlicher in negativer Hinsicht ist es, daß ein entsprechendes Grundlagenwerk, Franco Venturis zuerst 1952 erschienene zweibändige Arbeit „Il Populismo Russo“, das in den folgenden Jahren in alle Weltsprachen übersetzt und entsprechend rezipiert wurde, hierzulande nicht nur nicht übersetzt, sondern, abgesehen vielleicht von einigen wenigen Spezialisten, auch nicht zur Kenntnis genommen worden ist. Über die Gründe dieser verpaßten Gelegenheit zu spekulieren ist müßig; mag sein, daß es im Osten als antikommunistisch und im Westen als nicht antikommunistisch genug interpretiert wurde, schließlich sind deutsche Historiker, welcher Provenienz auch immer, nicht zuletzt für ihre ideologische Borniertheit bekannt. Ettore Cinnella stellt in seinem Beitrag nicht nur Venturis Werk vor, das sich mit den verschiedenen populistischen sozialistischen Strömungen im Rußland des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts beschäftigt, sondern vermittelt auch einen Einblick in Hintergründe und Motivationen von Venturis Beschäftigung mit diesem Thema.
Zu den sicherlich nicht unbedeutendsten Hinterlassenschaften der sogenannten „Studentenbewegung“ der sechziger und siebziger Jahre gehören die als „Raubdrucke“ in die Geschichte des Buchwesens eingegangenen Nachdrucke zuerst von vergessenen und vergriffenen Werken insbesondere der verschiedenen Strömungen der sozialistischen Bewegung, später dann auch von seinerzeit aktueller Literatur, die auf diesem Wege etwas verbilligt angeboten werden konnte. Albrecht Götz von Olenhusen, Sammler und Bibliograph von Raubdrucken, stellt in seinem Beitrag das von ihm aufgebaute und geleitete Freiburger Raubdruck-Archiv vor. Daneben präsentiert er zwei bisher nicht veröffentlichte Dokumente - einen Bericht der Rechtsabteilung des „Börsenvereins des Deutschen Buchhandels“ vom Dezember 1975 sowie einen Bericht des „Bundeskriminalamtes“ vom November 1976 -, die beide einen allerdings strikt interessegeleiteten Eindruck von der Raubdruckszene in der Mitte der siebziger Jahre vermitteln.
Der Bürgerkrieg in den Jahren zwischen 1936 und 1939 und die anschließende jahrzehntelange Herrschaft Francos haben die spanische Gesellschaft sozial und politisch zutiefst gespalten. In einer Zeit allerdings, in der in den westlichen Gesellschaften alle Welt, zumindest alle Parteien des bürgerlichen demokratischen Spektrums nach der sogenannten „Neuen Mitte“ streben und deren inhaltliche Leere mit nichtssagenden Floskeln zu drapieren versuchen, gehört die kollektive historische Amnesie zum programmatischen Anliegen moderner Politik. Unter den Stichworten „Historisierung“ und „Normalisierung“ werden politische und soziale Konflikte hinwegeskamotiert und die Konturen einer schönen neuen Welt werden schamlos in die Vergangenheit projiziert. Das von spanischen Historikern verfaßte Manifest Um die Vergangenheit kämpfen verweist am Beispiel neuerer Tendenzen in der historischen Aufarbeitung der Geschichte des spanischen Bürgerkrieges einmal mehr darauf, daß Kämpfe um die Vergangenheit immer auch Auseinandersetzungen um Gegenwart und Zukunft sind.